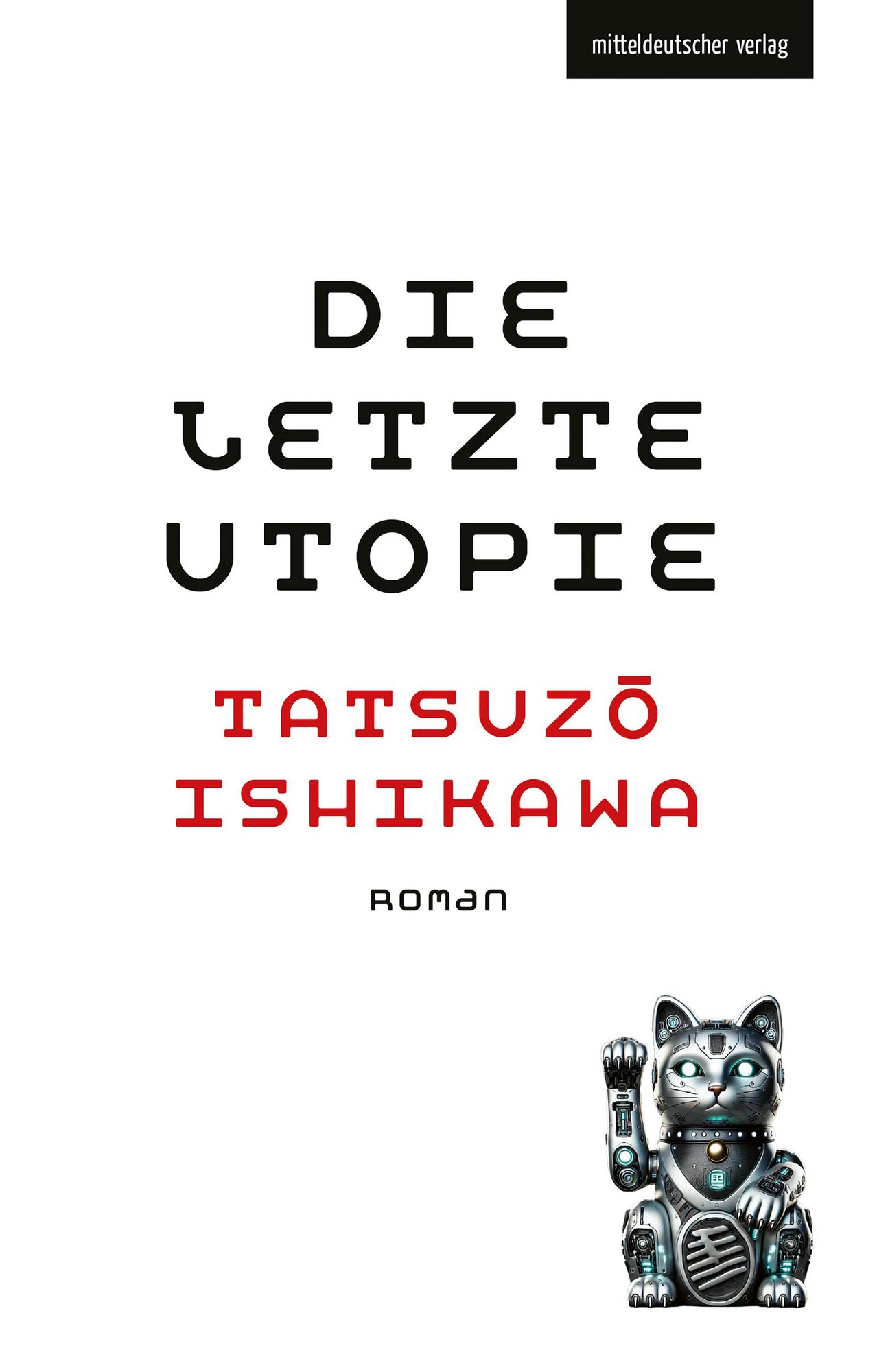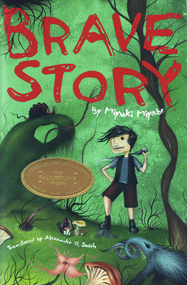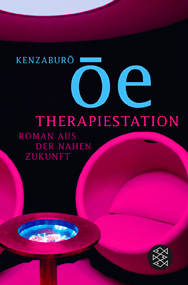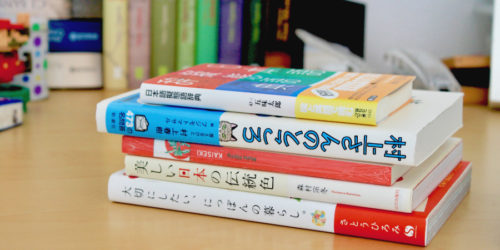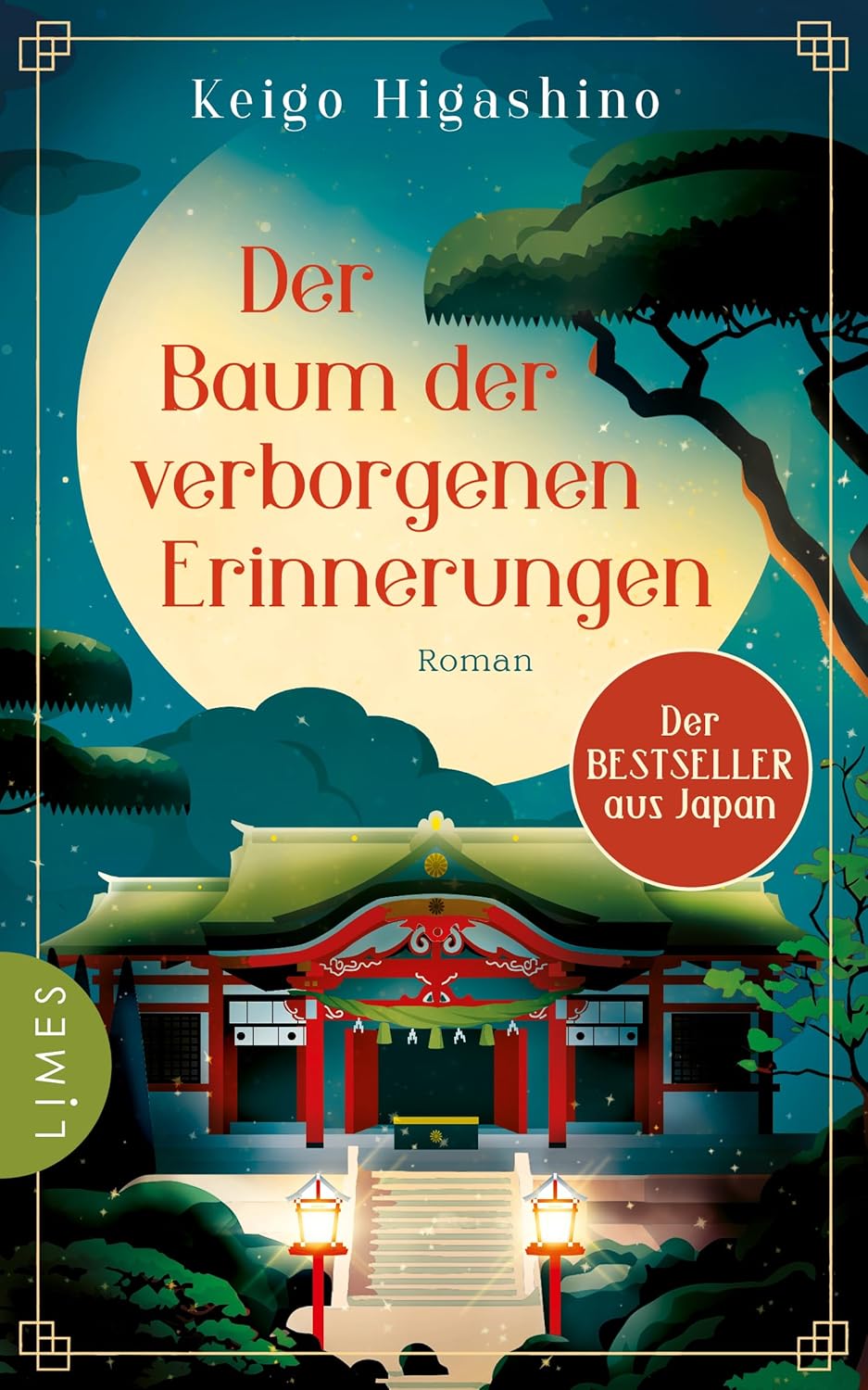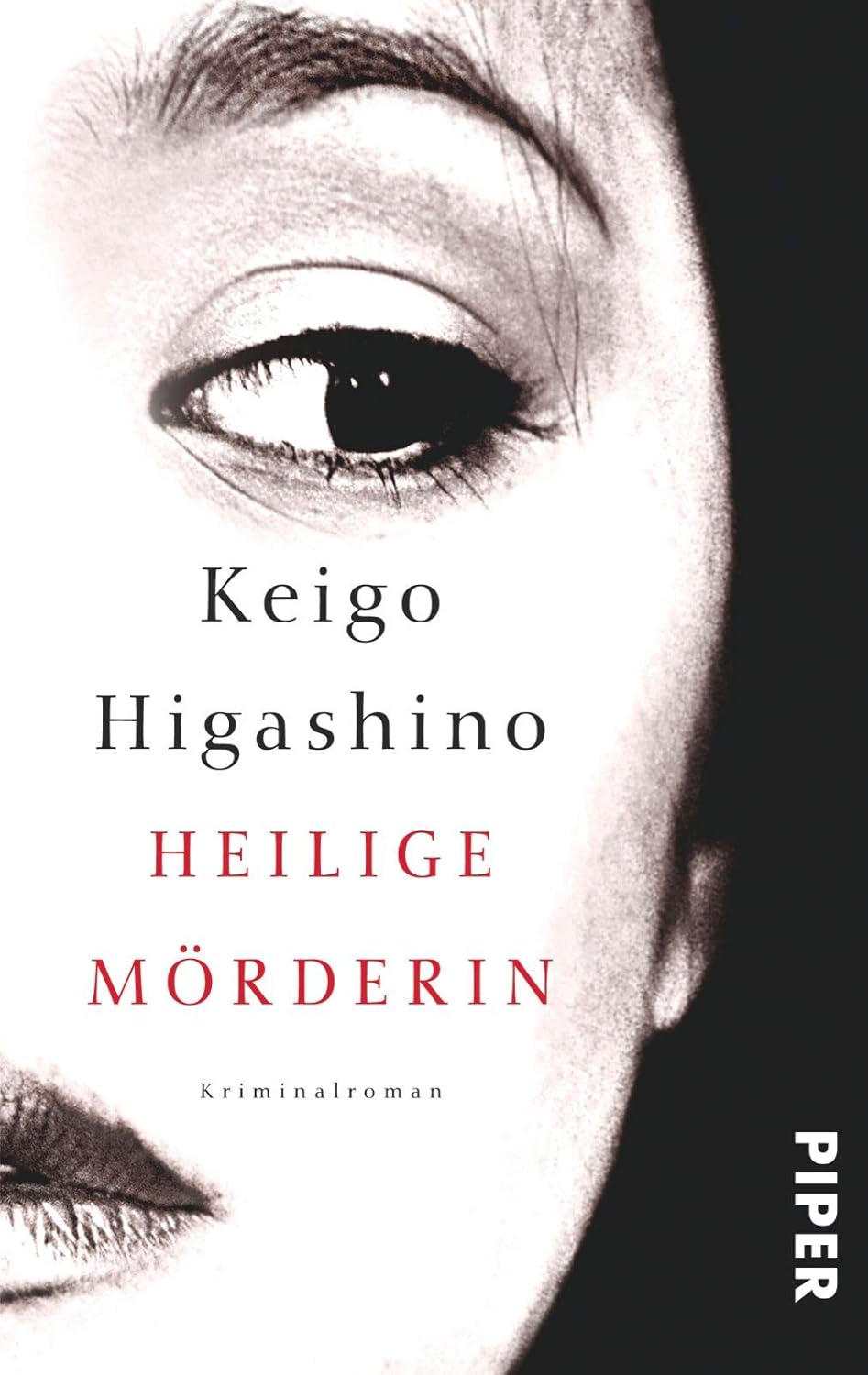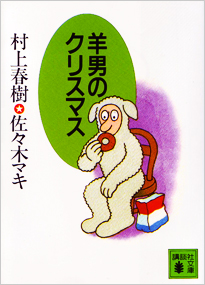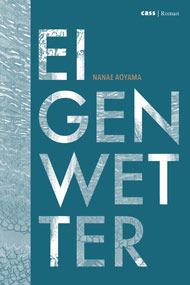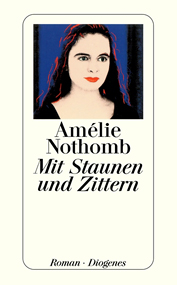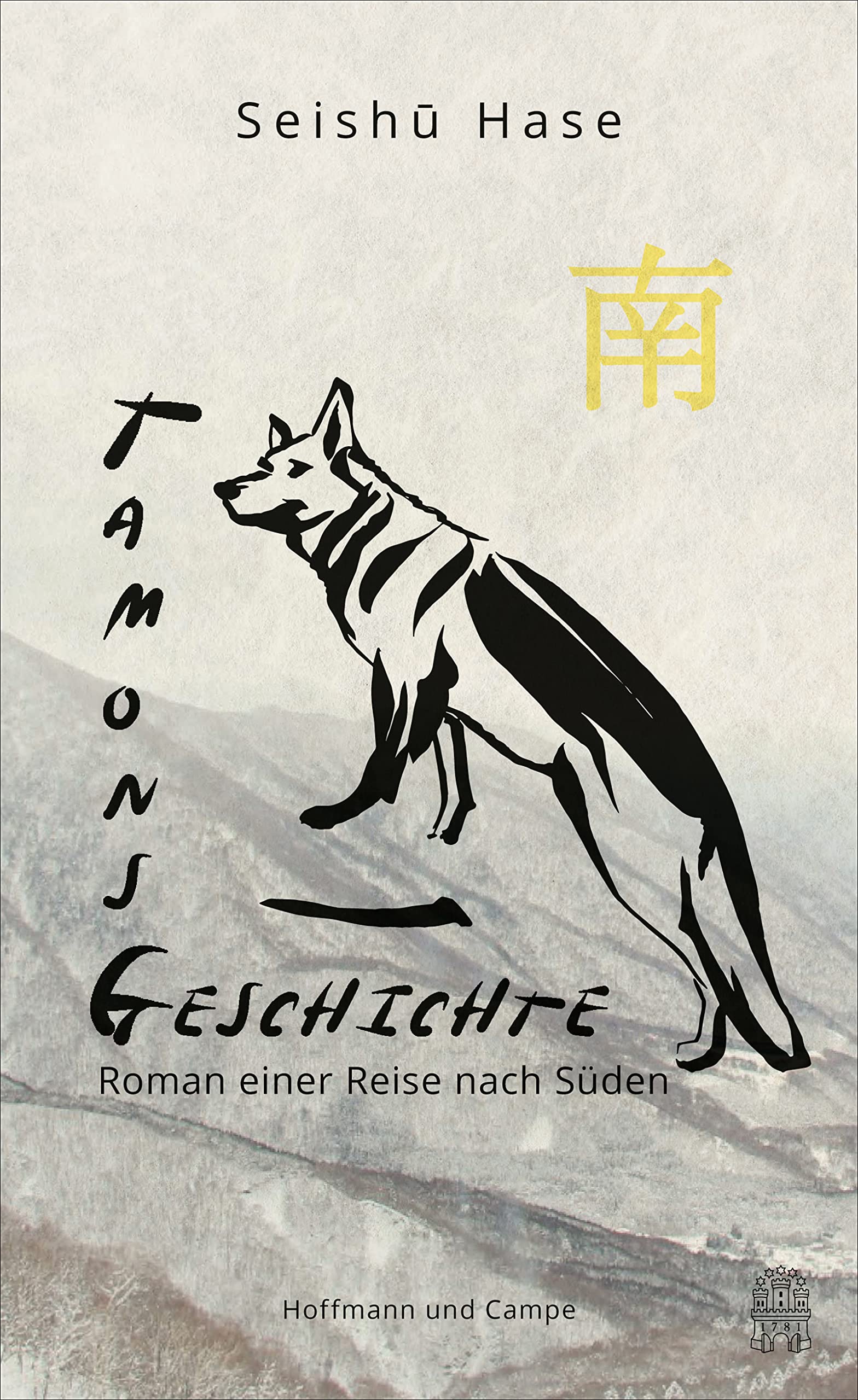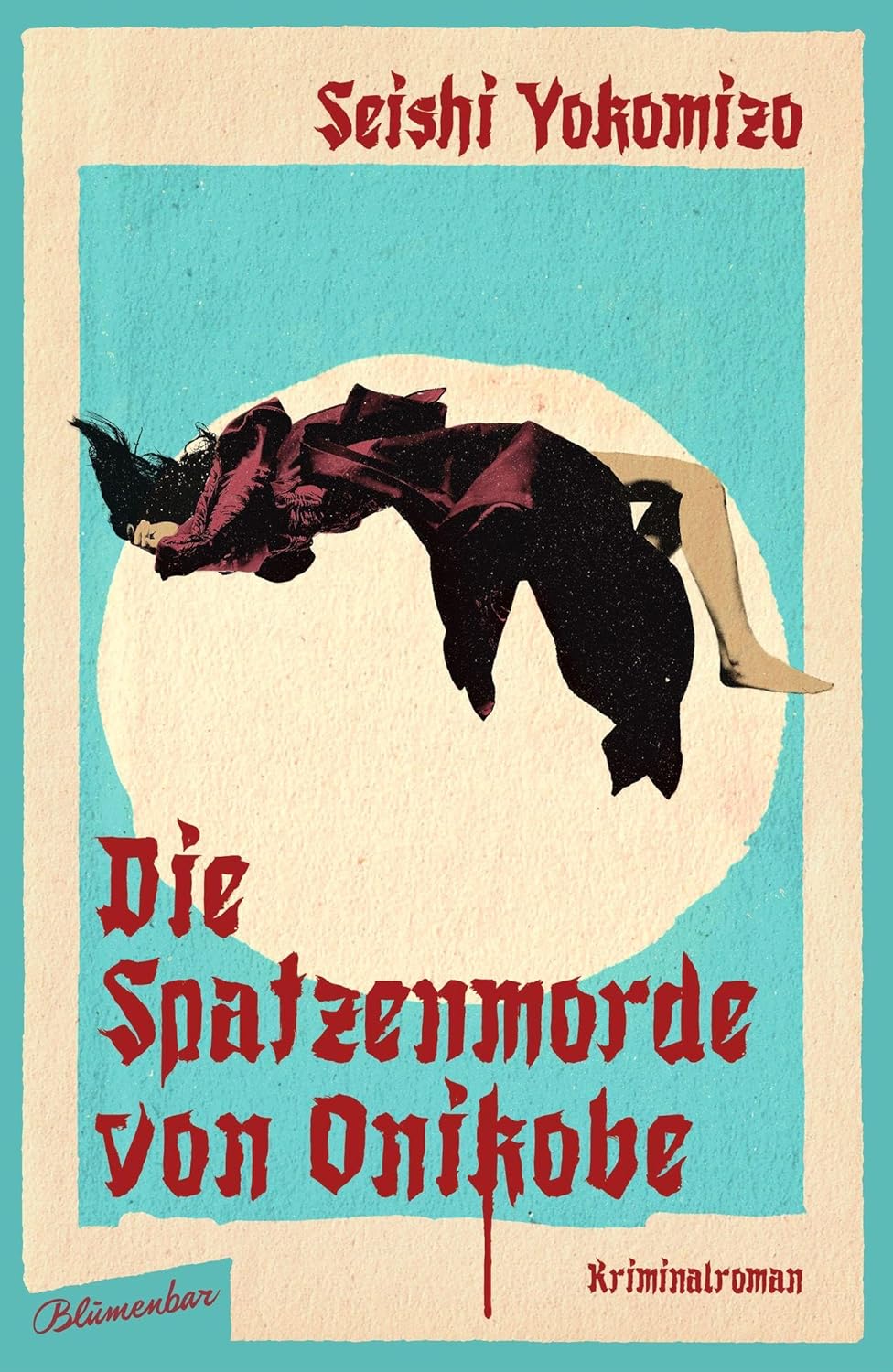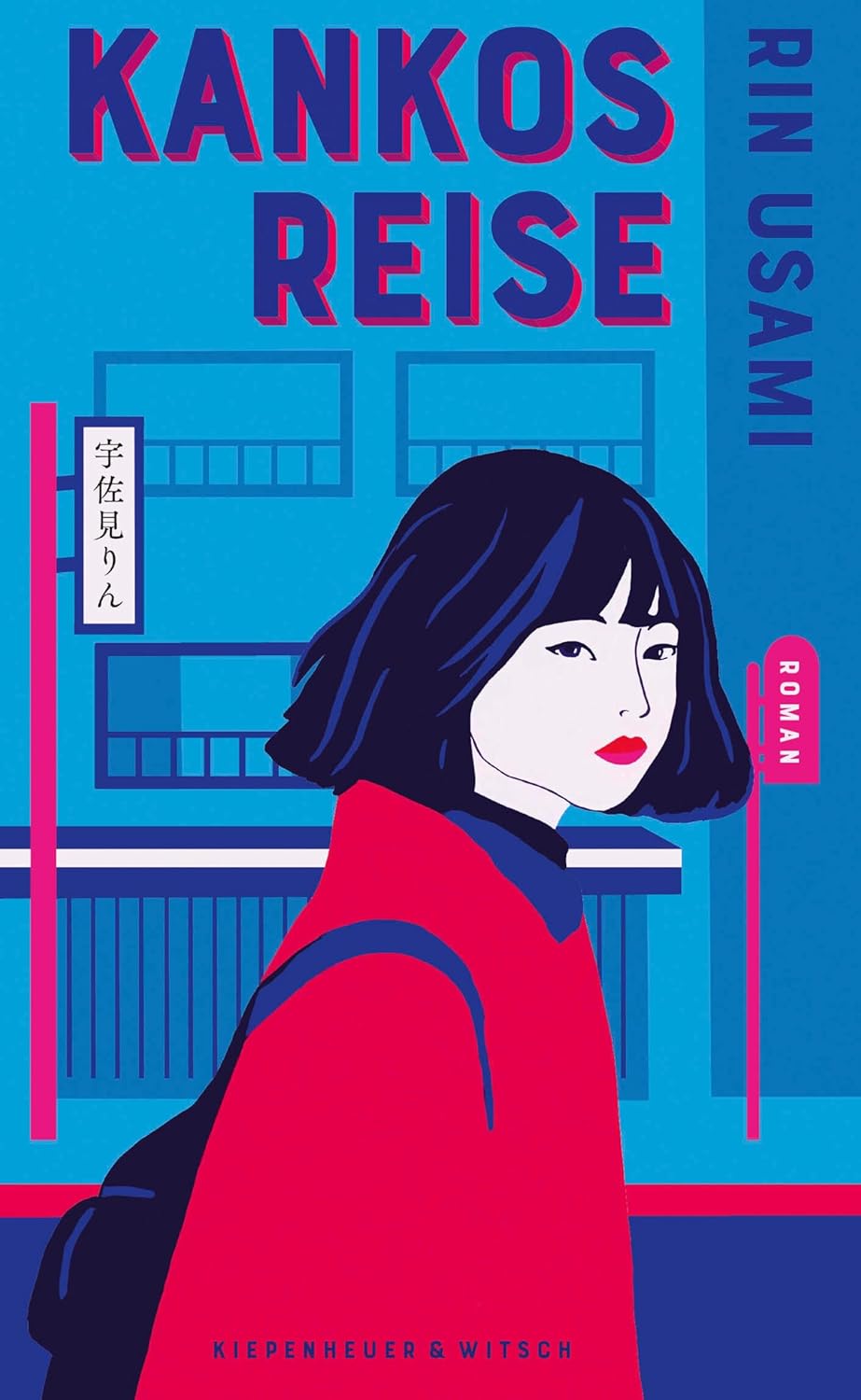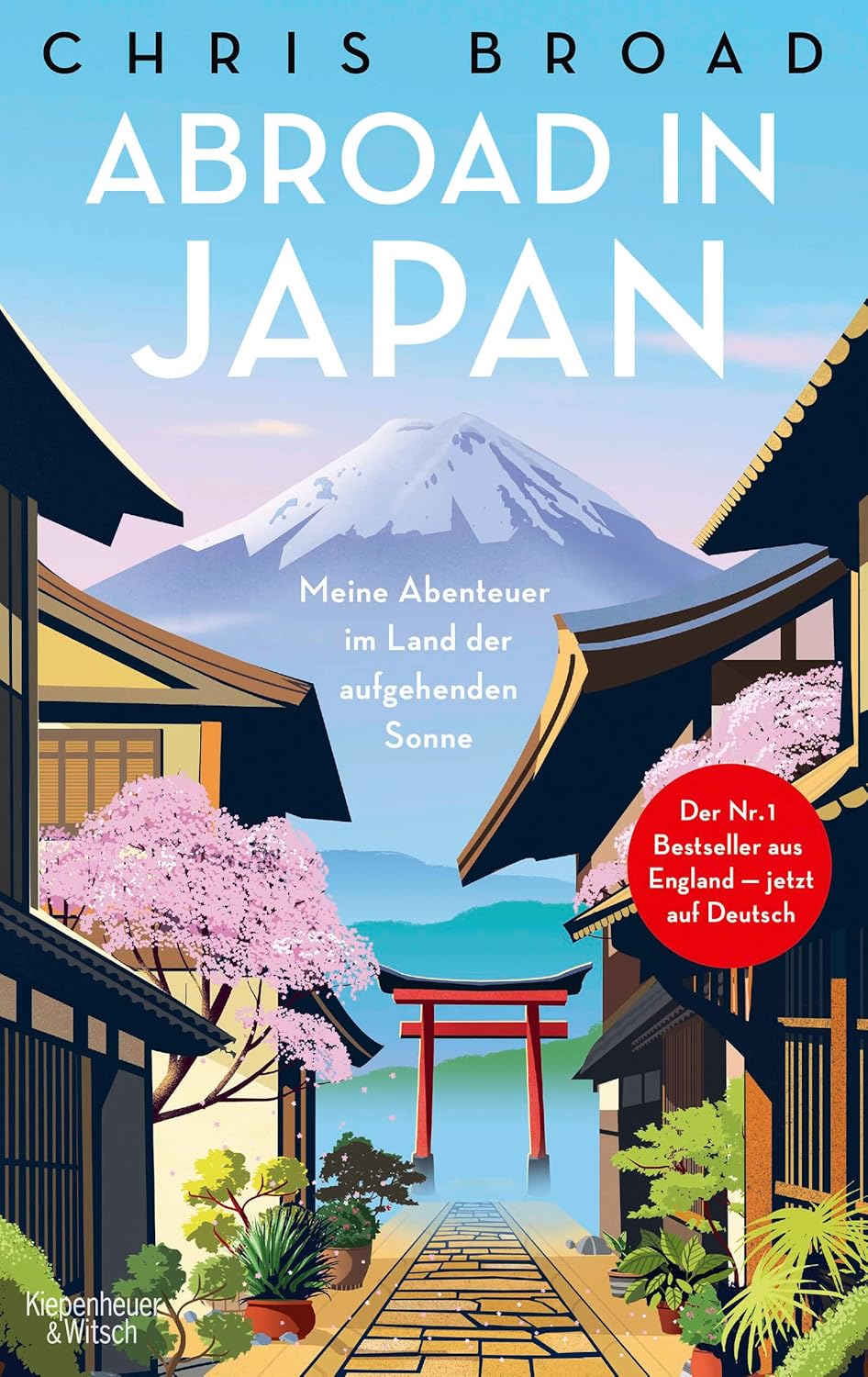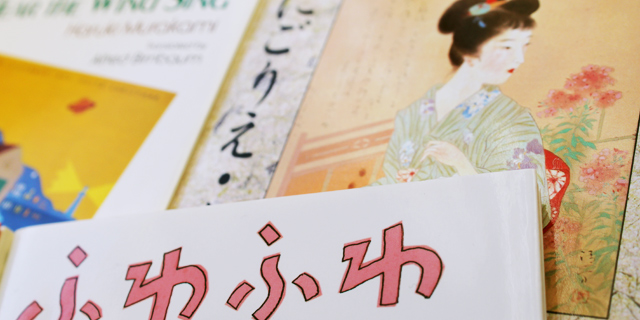Es ist inzwischen schon fünf Jahre her, dass mit Yoko Ogawas Insel der verlorenen Erinnerung ein japanischer Roman, den man in die Sparte dystopischer Romane einordnen könnte, in Deutschland erschienen ist. Mit die letzte Utopie bringt der Mitteldeutsche Verlag nun endlich wieder einen klassischen dystopischen Roman heraus.
Besonders spannend an dieser Veröffentlichung ist ihr Alter: Bereits 1952 erschien die letzte Utopie. Zeitlich reiht sie sich damit zwischen die großen Dystopie-Klassiker wie 1984 (1949) von George Orwell, Fahrenheit 451 (1953) von Ray Bradburry und Clockwork Orange (1962) von Anthony Burgess ein.
Stilistisch allerdings unterscheidet sich Ishikawas Roman fundamental. Anders als in den genannten Werken, in denen ein fester Hauptcharakter die dystopische Welt erlebt, besteht die letzte Utopie ausschließlich aus Berichten aus dem Rundfunkarchiv der Nachrichtenagenturen, insbesondere der United Asia.
Zwar treten in diesen Berichten auch prominente Figuren wie etwa der Mediziner Dr. Johannes auf, der es durch seine Forschung geschafft hat, Schwangerschaften auf drei Monate zu verkürzen. All diese prominenten Figuren werden jedoch in den Berichten sehr nüchtern-sachlich dargestellt und nur lebendig dadurch, dass sie mit Redebeiträgen zitiert werden.
Der Autor Ishikawa schafft es so jedoch trotzdem, ein sehr detailliertes Bild seiner dystopischen Welt aus dem Jahr 2026 zu entwerfen: Nach mehreren Weltkriegen hat die gesamte Erde sich zu einer Republik zusammengeschlossen und lebt in Frieden. Unliebsame Arbeiten werden von Robotern verrichtet. Die klassischen Medien Print, Radio und Fernsehen dominieren eine wohl immer noch recht analoge Welt, es scheint aber auch neue Errungenschaften wie kabellose Telefone und einen Atomantrieb für Busse und Boote zu geben.
Was gerade die Vorhersagen über den technischen Fortschritt angeht, kann eine über 70 Jahre alte Dystopie natürlich nicht alles korrekt vorhersagen. Während die Roboter in Ishikawas Republik im Jahr 2025 deutlich weiter entwickelt sind als im tatsächlichen Jahr 2025, findet bei Ishikawa erst 2027 der erste Versuch für eine Mondlandung statt. Auch die Überbevölkerung ist ein Thema. Statt mit modernen Verhütungsmitteln wie der Pille wird dieses Problem mit einer Medizin gelöst, die Abneigung gegen das andere Geschlecht auslöst und die Menschen so überwiegend homosexuelle Paare bilden lässt.
Die Republik, die aus einer Art Föderation der einzelnen heute existierenden Länder besteht, erinnert in ihrem Entwurf ein wenig an das Ideal des Kommunismus: Alle leben gleichberechtigt, mit gleicher Bildung und gleichem Einkommen friedlich zusammen. Doch wie in jeder Dystopie hat diese scheinbar paradiesische Gesellschaft auch Nachteile. Diese möchte ich aber nicht vorwegnehmen, um die Lesevorfreude nicht zu trüben.
Der Autor Tatsuzō Ishikawa ist bereits 1985 verstorben, zählte aber zuvor zu den bedeutendsten Autoren japanischer Nachkriegsliteratur und war 1970 sogar Kandidat für den Literatur-Nobelpreis. Schon alleine, weil mit der letzten Utopie erstmals ein Werk von ihm ins Deutsche übersetzt wurde, ist es einen Blick in den Roman allemal wert. An einigen Stellen sollte der Roman aber auch vor seinem zeitlichen Hintergrund gelesen werden, gerade wenn Begriffe wie „Rasse“ oder „Mischlingsmädchen“ fallen.
Auch wenn durch die nüchterne, berichtsartige Erzählweise keine Emotionalität über einzelne Protagonisten aufkommen kann, lesen sich die Berichte aus dem Rundfunkarchiv doch spannend, da die Lage der einst so paradiesisch erscheinenden Republik immer beunruhigender wird.
Fazit
Wer sich auf den unkonventionellen Erzählstil einlässt, wird an dieser klassischen Dystopie sicher viel Freude haben.Verfasst am 27. April 2025 von Friederike Krempin