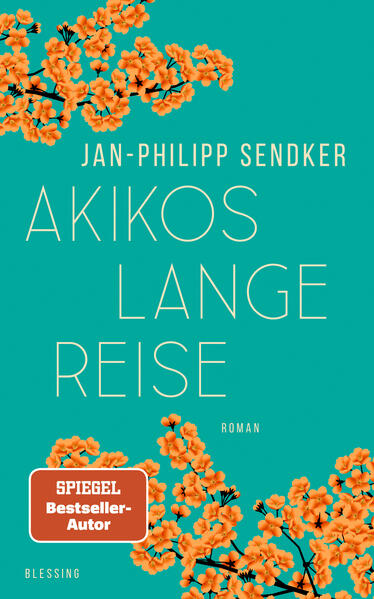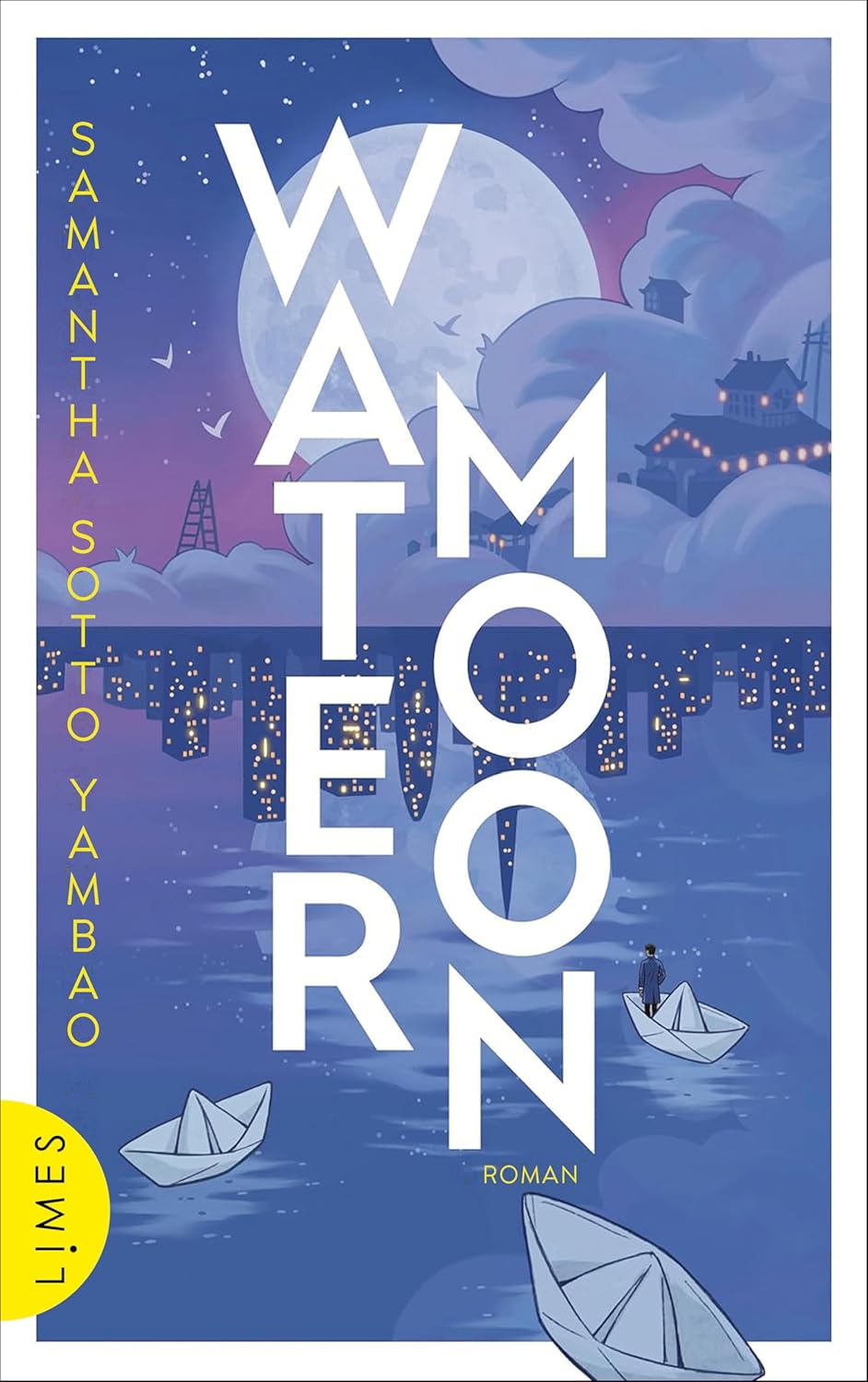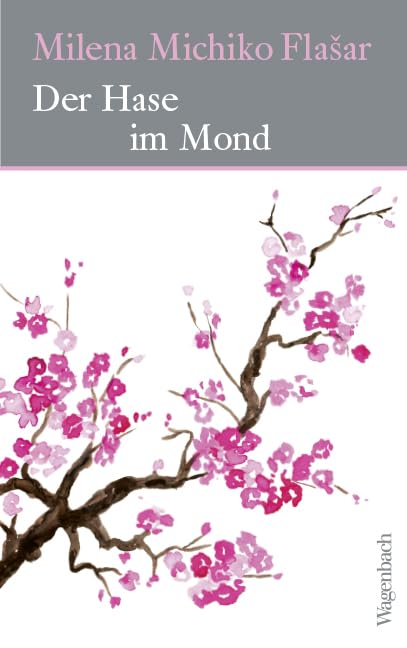Ein Mann wohnt über ein Jahr zusammen mit einer Frau, ohne es zu wissen? Auf der Basis dieser einfachen Zeitungsmeldung hat Éric Faye das Thema ausgeschmückt und einen Roman geschrieben.
Dabei trifft es die Bezeichnung „Roman“ eigentlich nicht so ganz, denn Zimmer frei in Nagasaki ist lediglich 110 Seiten dick und die Schrift zudem so groß, dass man das Buch in sehr kurzer Zeit beenden kann. Auch die Handlung ist recht „dünn“, sodass sich die Geschichte des Meteorologen Shimura wohl eher als ausgedehnte Erzählung charakterisieren lässt: In Shimuras Haus hat sich ohne sein Wissen eine Obdachlose eingenistet. An kleinen Anzeichen merkt er schließlich, dass jemand in seiner Wohnung ist und enttarnt sie. Es kommt zum Prozess gegen die Frau. Shimura beschreibt das Erlebte aus seiner Perspektive. Die Frau beschreibt das Erlebte aus ihrer Perspektive. Dann gehen beide auseinander.
Dabei schafft Faye es, dass die beiden Protagonisten absolut isoliert voneinander bleiben. Obwohl beide doch nah beieinander gelebt haben, entsteht kein Dialog. Kein Mal sprechen die beiden miteinander, nicht einmal im Gericht, hier kreuzt sich nur ihr Blick. Was bleibt also von dieser „dünnen“ Geschichte? Für Shimura ein Gefühl des Unbehagens:
Ich verstand, dass dieses gemeinsame Jahr, das sie und ich miteinander verbracht hatten, auch wenn sie mich nicht kannte und ich nichts von ihr wusste, mich verändern würden und dass ich schon jetzt nicht mehr genau der Gleiche war. (55)
Die Obdachlose Frau offenbart sich schließlich noch und erzählt ihre Lebensgeschichte. Und plötzlich kommt doch noch Dynamik in den ruhigen, dialoglosen, handlungsarmen Roman: Kurz vor dem Ende bringt sie plötzlich Themen ein – von einer katholischen Siedlung in Nagasaki und der Atombome, die alles zerstörte, von ihrer Arbeit in der Roten Armee im Untergrund. Aber noch ehe ein Bild dieser Frau entsteht, die zwar mittellos und der Eindringling, dafür aber tausendmal interessanter als der brave, leicht zwanghafte Shimura ist, endet Zimmer in Nagasaki.
Faye schafft es mit seinem Stil, das handlungsarme, stille, unauffällige Erzählen, das so oft japanischer Literatur zugeschrieben wird, nachzubilden. Zugleich hinterlässt der Roman damit durch die Geschichte, die keine Annäherung der Charaktere zulässt, einen seltsam transparenten Nachhall. Die Charaktere verblassen schnell, doch was bleibt, ist ein Gefühl von Einsamkeit. Und das ist dann Fayes Erzählung auch in erster Linie: Eine Geschichte von Isoliertheit und Vereinsamung, für die es keinen 500-Seiten-Roman braucht, sondern die auch auf 110 Seiten erzählt werden kann.