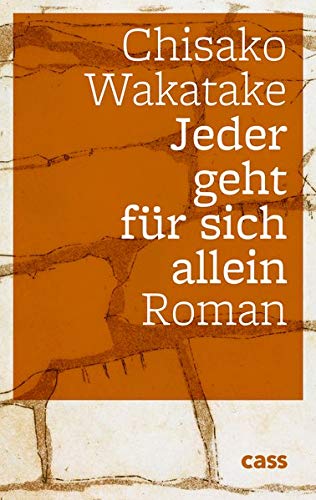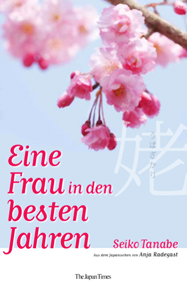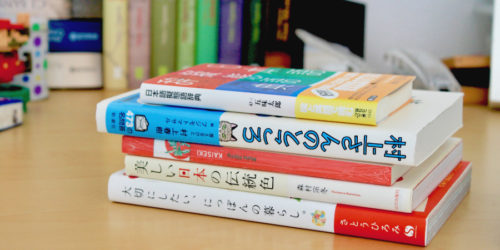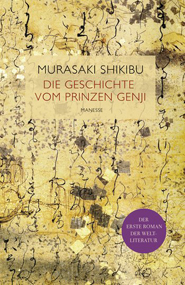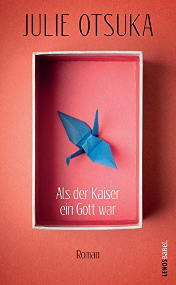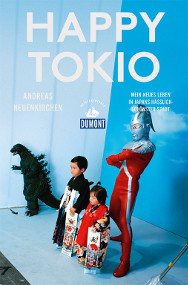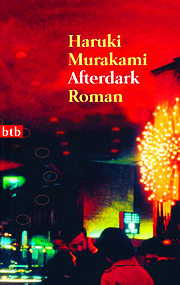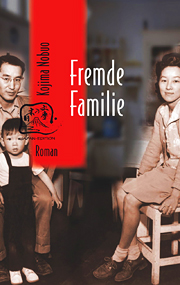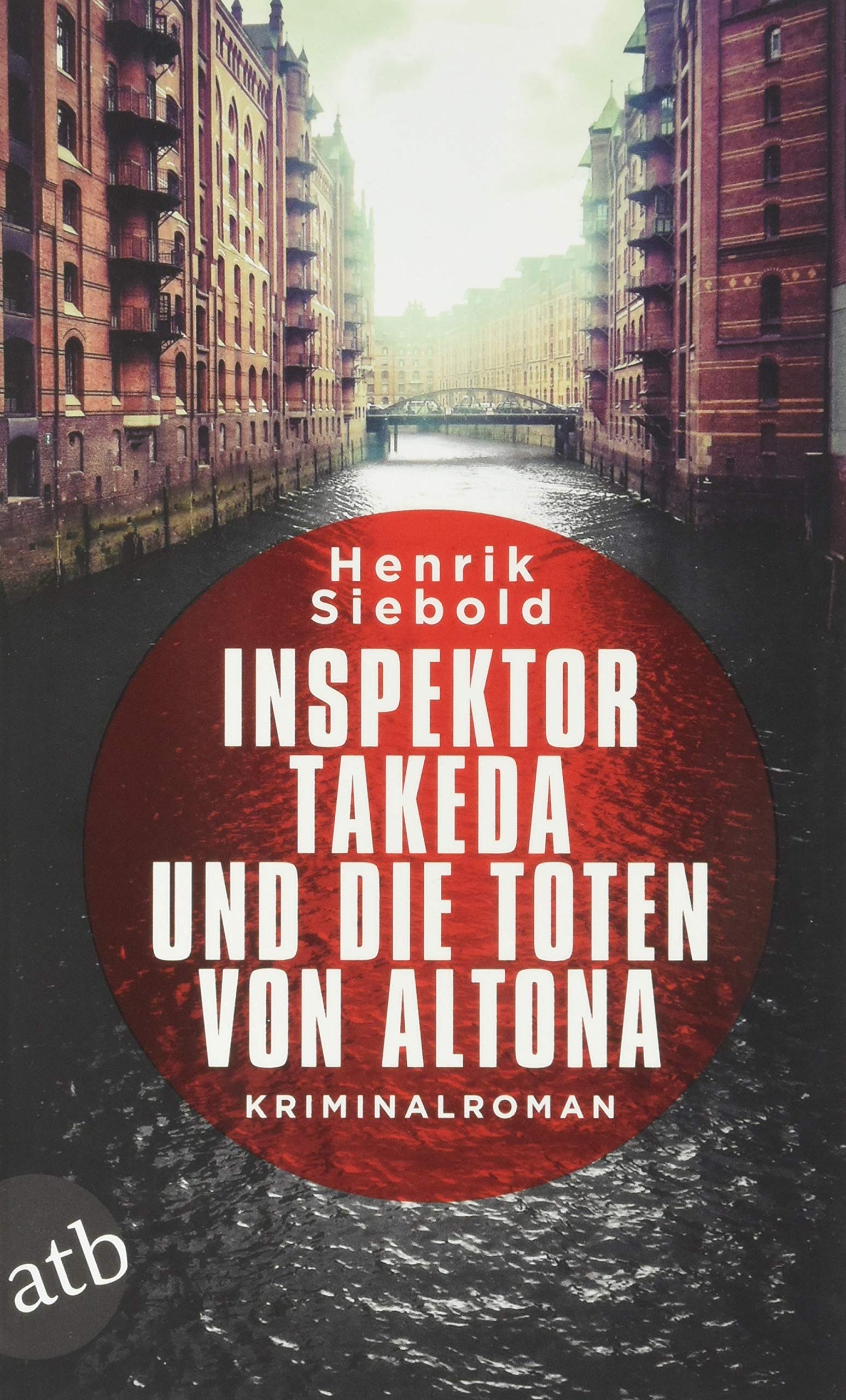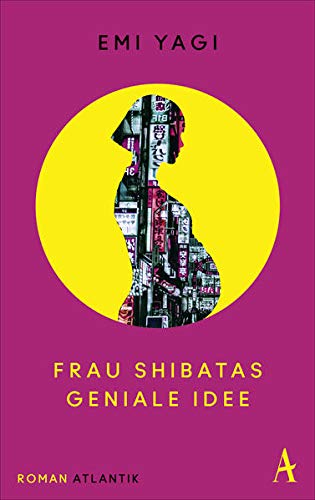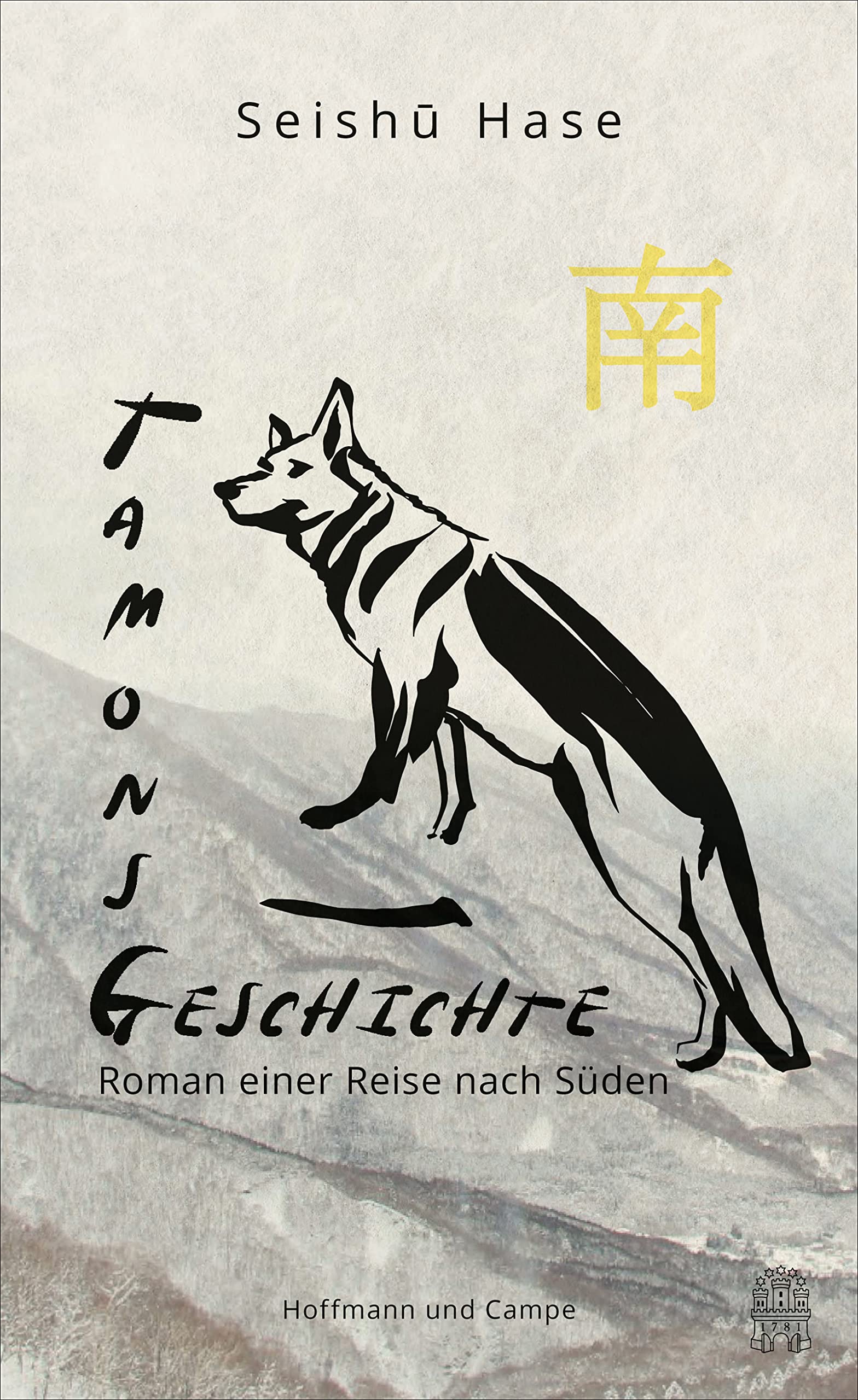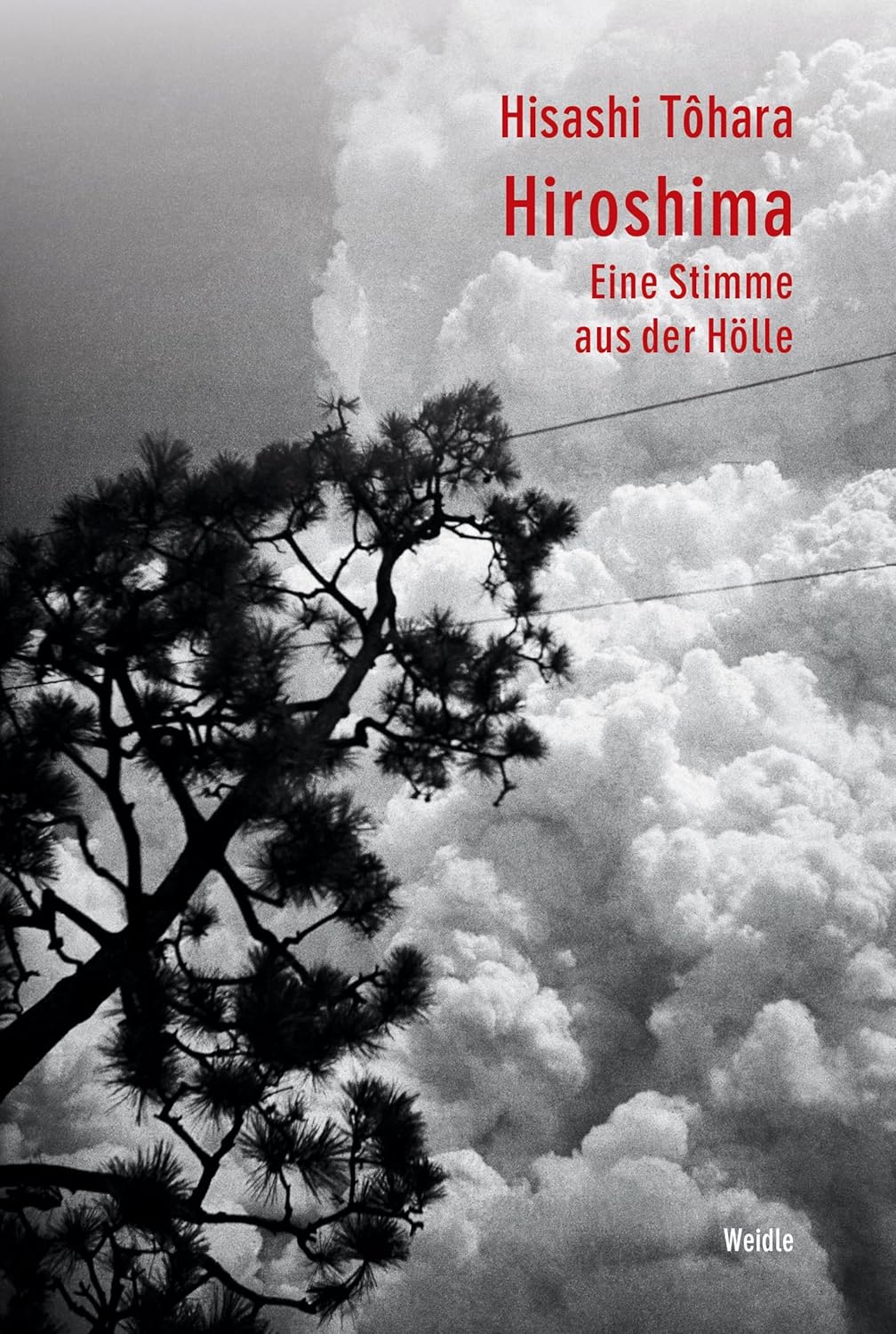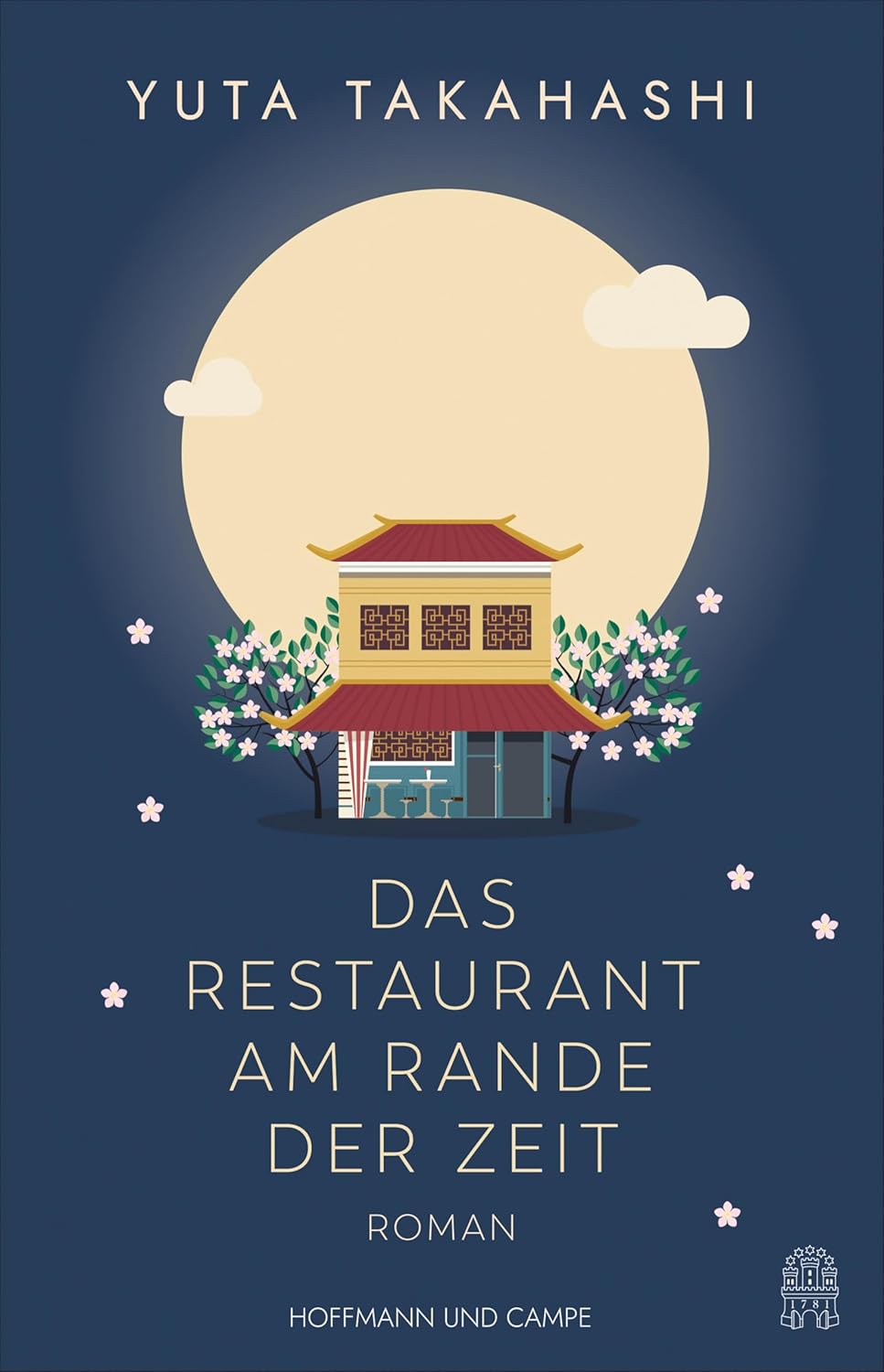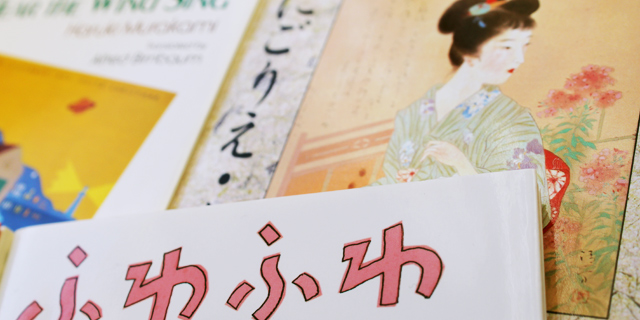„Die Kinder sind groß. Ihren Mann hat sie verabschiedet. Die Aufgaben, die die Welt ihr stellte, sind restlos erfüllt.“ (Zitat aus: Chisako Wakatake, Jeder geht für sich allein, S. 80)
Auf nur 108 Seiten erzählt die 74-jährige Momoko ihre Lebensgeschichte. Diese ist, wie das obige Zitat und auch der Romantitel sehr gut andeuten, in der Rückschau überwiegend traurig.
Als junge Frau streift Momoko ihren ländlichen Dialekt ab und zieht vom Land in das großstädtische Tokyo der 1970er Jahre. Sie möchte eine moderne Frau sein, jobbt in unterschiedlichen Läden und wohnt gemeinsam mit einer Freundin in einer kleinen Kammer. Doch schließlich verliebt sie sich, heiratet Shuzo und wird Hausfrau und Mutter.
Dieses Leben scheint für Momoko kein schlechtes Leben gewesen zu sein , doch in ihrer aktuellen Situation ist sie überwiegend traurig und einsam: Ihre Kinder haben sich von ihr entfremdet, den plötzlichen Tod ihres Mannes hat sie auch nach fünfzehn Jahren noch nicht überwunden.
„Die Momoko umgebende Wirklichkeit ist trostlos und blass, lebt sie wirklich in dieser Welt? Die ferne Vergangenheit kommt ihr im Vergleich dazu viel farbiger, viel lebendiger vor.“ (Zitat aus: Chisako Wakatake, Jeder geht für sich allein, S. 52)
Während Momoko in ihrer Einsamkeit beginnt, mit sich selbst zu sprechen, sprechen plötzlich auch fremde Stimmen zu ihr. Die Vergangenheit scheint sie nun – zum Ende ihres Lebens – wieder einzuholen, denn diese Stimmen sprechen ihren alten Dialekt aus der Heimat, den sie in Tokyo mühsam ablegen musste.
Im Originalroman sprechen diese Stimmen Tohoku-Dialekt. Bewundernswert ist hier die geleistete Übersetzungsarbeit: Nach der Übertragung ins Deutsche wurden die entsprechenden dialektalen Textstellen durch den Philologen Heinrich Schneider in das Erzgebirgisch-Vogtländische übertragen. Dieser Dialekt wurde gezielt ausgewählt, da er dem im Buch gesprochenen Dialekt am meisten ähneln soll.
Handwerklich ist diese Entscheidung nicht zu beanstanden, doch ehrlicherweise muss ich zugleich zugeben, dass der Dialekt den Textfluss erheblich stört und nicht ohne weiteres lesbar macht, wenn man ihn sich nicht laut vorliest oder zumindest lautlich vorstellt. In Zeiten, in denen auch digitale Textversionen möglich sind, hätte ich mir hier gut vorstellen können, dass man ggf. in einer digitalen Version zwei Lesevarianten hätte bereitstellen können, um den Text auch einen breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Insgesamt stellt Wakatakes kurzer Roman, – der übrigens auch den renommierten Akutagawa-Preis erhielt – eine interessante, wenn auch sehr melancholische Sicht auf ein gelebtes Leben dar, die dazu anregt, über die eigene Lebensgestaltung nachzudenken.
Fazit
Ein melancholischer Roman, der in stilistisch ungewöhnlicher Weise Bilanz über ein Leben zieht.Verfasst am 26. Februar 2025 von Friederike Krempin